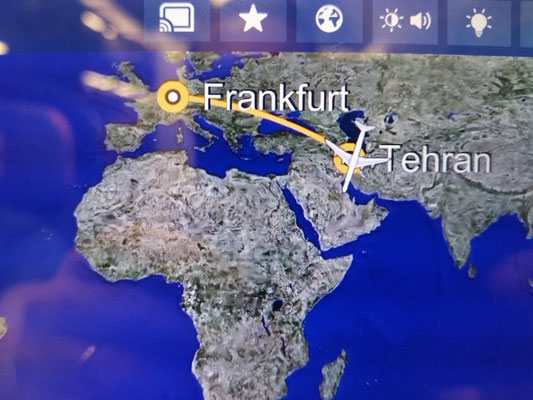Prolog
Uns ist klar, dass Georgien nicht zum Nahen Osten gehört. Auch für Länder wie Azerbaijan und Oman ist diese Zuordnung eigentlich nicht korrekt. Für unsere Reiseroute passt es aber trotzdem ganz gut, die geografische Schindluderei sei uns daher verziehen...
Georgien

Batumi soll zu einer Art neuem Las Vegas an der Schwarzmeerküste werden, und im zentralen Strandbereich ist das bereits deutlich zu sehen; da wird mit der ganz grossen Kelle angerichtet. Alle paar Meter werden gewaltige Bauprojekte futuristisch aussehender Hochhäuser angekündigt. Wer dort dereinst wohnen soll?
Zuerst ein wenig vom ganzen Pomp eingeschüchtert, entdeckten wir dann aber schon bald das «alte» Batumi, und das hat mit seinen vielen grossgewachsenen Bäumen und den engen Gassen durchaus seine Reize. Und überhaupt: endlich konnten wir mal einen Sonnenuntergang über dem Meer geniessen, -auf der anderen Seite des Tümpels mussten wir für ein ähnliches Spektakel jeweils früh aufstehen.
Da wir schon viel vom herbstlichen Greifvogelzug in Batumi gehört hatten, wollten wir uns dieses Spektakel keinesfalls entgehen lassen. Also kraxelten am zweiten Tag auf einen kleinen Hügel neben der Stadt. An dieser Stelle ziehen im September alljährlich zwischen 50 000 und 100 000 grosse Raubvögel durch, pro Tag! Diese Zahl alleine ist schon eindrücklich, aber was sie wirklich bedeutet, erkannten wir erst vor Ort. In einem endlos scheinenden Strom fliegen Vögel von Norden her ins Gebiet, lassen sich kreisend von der Thermik nach oben tragen und passieren anschliessend im Gleitflug den geografischen Flaschenhals in Richtung Süden. Eine Gruppe Freiwilliger, positioniert auf zwei Hügeln und ausgerüstet mit Ferngläsern, Klickzählern und Walkie-Talkies, bestimmt und zählt die durchziehenden Vögel; daraus können dann wichtige Erkenntnisse über die Bestandsentwicklung der Greifvögel abgeleitet werden. Bekannt ist das Ganze unter dem Kürzel BRC: Batumi Raptor Count.
Wir standen also da uns staunten wortwörtlich Löcher in den Himmel, als neben uns plötzlich jemand: «Hoi zäme!» sagte. Stefan und Marlène sind mit ihren beiden Kinder Lill und Vito schon seit längerer Zeit mit einem kleinen Bus unterwegs und ebenfalls naturbegeistert. Von ihnen bekamen wir eine kurze Einführung in die georgische Vogelwelt, einen Einblick in das ABC der georgischen Küche und die wichtigsten Begriffe und Floskeln für die Verständigung. Alles Dinge, die schon bald sehr nützlich wurden. Und, um ehrlich zu sein, haben wir es wirklich genossen, wieder mal ein bisschen Schweizerdeutsch sprechen zu können…
Batumi und Umgebung

Auf dem Weg zum Goderzi-Pass
Nach zwei Nächten, einer grossen Wäsche, einem Besuch beim türkischen Friseur und ganz vielen Zugvögel wurde es dann aber Zeit, auch selbst weiterzuziehen. Florentine, eine junge Frau aus Karlsruhe, die wir auf der Fähre kennengelernt hatten, schloss sich uns für die Fahrt über den ersten Pass an. Wir rechneten mit 3 Tage für die 120 Kilometer mit 2000 Höhenmetern. Am ersten Tag machten wir ordentlich Kilometer und übernachteten in Dandolo bei einer Outdoor-Bar im Freien. Der Besitzer, der kurz vor dem Eindunkeln auftauchte, meinte, dies sei «Nooooooo Problem!» und bestand darauf, uns mit ein paar Gaben aus seinem Garten und einem Krug Wein zu versorgen. Die Tomaten, Birnen und Trauben waren unglaublich aromatisch, aber natürlich waren zwei vollen Kübel doch etwas zu gut gemeint.
Am zweiten Tag erreichten wir fast 1000 Meter über Meer, aber kurz nach der Kleinstadt Chulo geht’s erstens wieder bergab und zweitens ist die Strasse ab dort nicht mehr asphaltiert. Uns dämmerte langsam, aber sicher, auf was wir uns bei der Überquerung des Goderdzi einzustellen hätten. Zum Glück entdeckten wir ein kleines Guesthouse, dessen wunderschön grüne Grasfläche zum campen einlud. Der Besitzer Tornike meinte zwar, dass er auch schöne Zimmer hätte, aber wir wollten nach den Tagen in Burgas, auf der Fähre, in Batumi und im Freien unbedingt mal wieder unser Zelt aufstellen. Zum Znacht bewirtete uns Maria, die Mutter von Tornike, mit Köstlichkeiten aus dem Garten, Käsevariationen und allerlei Gebäck. Satt und zufrieden legten wir uns in die Schlafsäcke und hofften, die verbleibenden 1150 Höhenmeter am nächsten Tag zu packen. Darauf mussten wir dann aber noch vier Tage warten… in der Nacht wurde Selena von einem heftigen Brechdurchfall heimgesucht, an eine Passfahrt am nächsten Morgen war nicht zu denken.
Selena wurde in den folgenden Tagen von Tornikes Familie (Danke Maria!) wieder aufgepäppelt. Dank dieser Extra-Zeit im Ajaira-Tal bekamen wir spannende Einblicke in das Leben eines georgischen Haushalts, besuchten die Dorfschule, hatten Zeit zum Schreiben und vertieften unserer Georgisch-Kenntnisse. Als Selena wieder fit war, setzte Regen ein, und so blieben wir noch einen weiteren Tag bei Tornike, Maria und all ihren Relatives. Rückblickend hätte uns wohl kaum was Besseres passieren können, um so richtig in Georgien anzukommen, nur Selena hätte wohl gut auf den Auslöser für unseren Langzeitaufenthalt im Guesthouse Oasis verzichten können.


Die Passfahrt über den Goderdzi war weniger schlimm als befürchtet. Die Strasse ist zwar tatsächlich in einem sehr schlechten Zustand, aber es gab nur wenig Verkehr und mit unseren Velos können wir Schlaglöcher ja wieselflink umfahren. Als Autofahrer wird man da wohl mehr und heftiger durchgeschüttelt. Da es tags zuvor geregnet hatte, war zwar alles ein wenig schlammig, aber das schien uns das besser Los zu sein als die durch Autos und Laster aufgewirbelten Staubwolken bei trockener Strasse. Oben angekommen war die Freude gross, und nach ein paar «Gipfel»-Fotos hielten wir bei der Abfahrt Ausschau nach einem geeigneten Lagerplatz. Gut 400 Höhenmeter unterhalb des Passes wurden wir fündig, und nach einem feinen Znacht schliefen wir, trotz donnerndem Gewitter und schrill rufenden Waldkauzweibchen, steintief ein.
Zusammen mit Florentine fuhren wir noch bis nach Akhaltsikhe, der ersten grösseren Stadt nach unserer Pass-Querung. Florentines Weg führte nun nordöstlich nach Tbilisi in die Hauptstadt, und wir zogen südöstlich nach Ninotsminda. Dies bedeutete zwar wiederum einen grossen Anstieg, aber Georgien gefiel uns inzwischen so gut, dass wir das gerne in Kauf nahmen.

Sowieso hat sich unser Tagesrhythmus in Georgien stark verändert. Einerseits werden die Tage auch hier immer kürzer, andrerseits sind die Strassen ein dauerndes Hoch und Runter. Wo wir in Europa noch 70-90 kilometrige Tagesetappen geplant haben, sind wir hier mit 30-50 Kilometern meist gut bedient. So haben wir nachmittags Zeit, um kleine Wanderungen, Vogelbeobachtungen oder Ausflüge zu kulturellen Stätten zu unternehmen. Aber meistens ergibt sich sowieso eine Kombination aus allen dreien.
Auf dem Weg zur Hochebene besichtigten wir die Höhlenstadt Vardzia. Ein grosser Teil der Anlage wurde durch ein Erdbeben zerstört, aber vor gut 800-900 Jahren sollen hier bis zu 50 000 Menschen gelebt haben. Eine unglaubliche Geschichte in einer unwirklichen Kulisse hoch oben im Kleinen Kaukasus.
Ninotsminda liegt inmitten der Javakheti-Schutzgebiete, die im Grenzgebiet von Georgien, der Türei und Armenien angesiedelt sind. Hier machten wir zwei Tage Rast, radelten zu verschiedene Seen, sahen Pelikane auf 2000 Meter über Meer gegen starken Wind anfliegen, entdeckten einige uns bisher unbekannte Vogelarten und lernten die komplizierte und aufwühlende Geschichte der Bewohner kennen. Ninotsminda liegt zwar noch in Georgien, aber 90% der Bevölkerung sind Armenier. Besatzung, Vertreibung, Umsiedlung… es gibt wenig, was diese Menschen im letzten Jahrhundert nicht erleiden mussten. Eine sehr spezielle Stellung nehmen in dieser Gegend die Duchoborzen ein, sozusagen eine religiöse Minderheit innerhalb der armenischen Minderheit. Als wir in einem kleinen Dorf nah Ninotsminda einkauften, luden uns die Bewohner ein, die traditionellen Häuser der Duchoborzen anzuschauen und zu fotografieren. In unseren Funktionskleidung kamen wir uns um 100 oder 200 Jahre fehl am Platz vor, aber schön und faszinierend war der Einblick in die tatsächlich noch bewohnten Gebäude allemal!

Tbilisi ruft
Nach zwei Wochen in eher abgelegenen Gebieten spürten wir mehr und mehr den Ruf der Grossstadt. Unsere Räder benötigten dringend einen Bremsen-Service, und in Tbilisi würde es einen guten Mech dafür geben. Also radelten wir, was das Zeug hielt, und waren bereits nach zwei statt der geplanten drei Tage in der georgischen Kapitale.
Georgische Autolenker sind schon auf dem Land ein Ereignis: Verkehrsregeln werden flexibel interpretiert, es wird bei jeder (meist freundlich gemeinter) Gelegenheit gehupt, ein Drittel der Wagen sind rechtsgesteuerte englische Importautos, Hindernisse (Kühe, Schweine, Radfahrer und Schlaglöcher) werden mit stoischer Gelassenheit umfahren und der Zustand der Fahrzeuge reicht von sieht-aus-wie-neu bis hin zu wow-das-fährt-tatsächlich-noch. Wenn dann in der Hauptstadt eine Million Georgier aufeinandertreffen; herrlich! Und für uns als Velofahrer interessanterweise kein Problem: Wir lassen uns einfach von der Strömung mitziehen, flitzen zwischen den Spuren hin- und her, kommen rascher voran als die endlosen Autokolonnen und können Baustellen, Polizisten und anderen Hindernissen locker ausweichen. Als Schweizer Velofahrer hat man anfangs noch ein latent schlechtes Gewissen, wenn man sich ab und zu auf dem Gehsteig durch die Massen an Fussgänger schlängelt, aber wenn einem dann sogar Motorräder und Kleinwagen mit derselben Taktik begegnen, relativiert das alles.
Die kleine Wohnung, die wir in Tbilisi für fünf Nächte gebucht hatten, stellte sich als absoluter Glücksfall heraus. Obwohl nur knapp 200 Meter vom Zentrum entfernt, ist es in der in einem Innenhof versteckten Wohnung fast so ruhig wie auf dem Land. Der Eingang ist ebenerdig, und so können wir unsere Räder gut geschützt parkieren. Der Velomech hat ganze Arbeit geleistet und die Räder sind fit für die nächsten Monate on the road. Sie glänzen wieder wie neu, -etwas, was wir eigentlich lieber vermieden hätten... Wir geniessen gutes Essen, kaufen herrliches Brot beim französischen Bäcker (Boulangerie Paul!) um die Ecke, gehen ins Kino, besuchen Museen, wandern in der Stadt umher, lesen, schreiben und studieren Kartenmaterial und Höhenreliefs.
Georgien blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück, die allerorts erlebbar ist. Es gibt grosse Spannungsbögen zwischen sehr armen Regionen und der reichen Hauptstadt, zwischen Orten aus
vergangenen Zeiten und der globalisierten Moderne. Die Menschen sind stolz auf ihre Traditionen und Erzählungen, ohne dass es je auch nur im Ansatz nationalistisch wirkt; nie hören wir ein Wort
gegen oder über Die Anderen. Der Konflikt mit Russland ist noch immer eine unverheilte, ja gegenwärtige Wunde, und doch werden die vielen russischen Touristen durchwegs respektvoll
behandelt; es wird klar unterschieden zwischen Putins Okkupations-Politik und den Russen als Menschen. Wir sind unsicher, ob wir tatsächlich in Asien oder eben doch noch immer in Europa sind. Die
Georgier sollen sich selbst ja als Balkon Europas bezeichnen. Als wir in einer Runde fragen, ob sie sich selbst eher zu Europa oder zu Asien zählen, folgt prompt die lachende Antwort:
«Eurasia!», und auf die Folgefrage: «Wollt ihr zur EU gehören?», sagt jemand, ohne zu zögern: «Ja!», und jemand anderes nach kurzem Überlegen: «Wir wollen keinen Einfluss von Russland.» Später
lernen wir in Tbilisi Leute kennen, die mit China Geschäfte machen und von Chinas Projekt der New Silkroad profitieren. Und da kommen wir zur Einsicht, dass sich Georgien aufgrund seiner
Lage an der Schnittstelle zwischen den Grossregionen Europa, Russland und Restasien einer klaren Zuordnung entzieht. Oder dass hier der Begriff Eurasien so gut passt wie sonst kaum; Daraus
ergeben sich viele Chancen, aber darin liegt eben auch viel Spannungspotential. Die Georgier haben, so scheints, schon längst gelernt, damit umzugehen.
Tschau Tbilissi, hallo Wildnis
Haben wir im letzten Bericht den georgischen Verkehr gelobt? Nach unserer Abreise aus Tbilissi nehmen wir alles zurück: Vielleicht lags am Regenwetter, aber die Fahrt entlang des Kacheti-Highways war echt eine Herausforderung: Lärmige, uns haarknapp überholende Lastwagen und Autos, swimmingpoolgrosse Spritzpfützen, Dieselqualm ohne Ende… Wir sind bis heute nicht ganz sicher, wo die alle hinwollten, aber wir waren superfroh, als wir den Lärm nach zwei Fahrtagen hinter uns lassen konnten. Nach einem Abstecher ins touristisch herausgeputzte Sighnaghi, einem malerischen Dorf an malerischer Lage, unternahmen wir noch einen Abstecher in den Vashlowani Nationalpark an der Grenze zu Azerbaijan.
Schon vor dem Vashlowani Nationalpark treffen wir auf faszinierende Landschaften...
Damit man überhaupt in dieses Schutzgebiet darf, benötigt man eine Erlaubnis von der Nationalparkbehörde in Dedopliszqaro. Im Besucherzentrum wurden wir nett empfangen und beraten, und die Rangerin hat uns schliesslich sogar eine Fahrerin organsiert, die uns in den Park bringen und zwei Tage später wieder abholen würde. Im Park selbst darf man nur an drei Orten campen, und das klang in unseren Ohren absolut verlockend. Also packten wir alles Nötige in unsere grosse Tasche, kauften 10 Liter Trinkwasser und Essen für zwei Tage und trafen am nächsten Morgen unsere Fahrerin Julia vor dem Besucherzentrum. Nachdem alles im Geländewagen verstaut war, mussten wir noch zur georgischen Grenzbehörde, die etwas ausserhalb des Städtchens ist. Dort wurde unsere Permission von diversen Beamten geprüft, die Pässe wurden begutachtet, weitere Papiere wurden erstellt, Stempel auf Formulare gesetzt, das alles nochmals von ranghöheren Beamten visiert… Schlussendlich bekamen wir ein Papier, das uns den Aufenthalt für zwei Nächte offiziell erlaubte und im Fall der Fälle den azerbaijanischen oder georgischen Grenzbeamten auszuhändigen sei.
Unser Camp lag gut 60 Kilometer von Dedopliszqaro entfernt, und nur schon die Fahrt durchs Niemandsland dorthin war ein Erlebnis; Uns wurde klar, wie abgelegen wir die nächsten Tage sein würden. Die Landschaft wurde zunehmend unwirtlicher, -zuerst sehr flach und dann sehr zerklüftet, -und nach einigen Kilometern Fahrt durch trockene, schluchtenartige Täler stoppte Julia, zeigte auf ein paar Büsche und bedeutete uns, dass hier Endstation sei. Zu unserem Erstaunen (und zu unserer Freude) waren wir die einzigen weit und breit, aber ehrlich gesagt hätte sich auf dem «Campinglatz» auch kaum Platz für ein weiteres Zelt gefunden. Handyempfang? -Fehlanzeige. Es blieb also nur zu hoffen, dass Julia uns wie vereinbart abholen würde.
Nie zuvor haben wir auf unserer bisherigen Reise so viele Sterne gesehen, noch nie Saturns Ringe mit dem Fernrohr so deutlich erblickt, nie so tief und wohlig die Einsamkeit gespürt; die Stille wurde auch tagsüber nur durch unsere eigenen Schritte und ab und zu von rufenden Vögeln und davonhuschenden Echsen durchbrochen. Nach der ersten Nacht wurden wir von singenden Blaumerlen und gackernden Chuckarhühnern geweckt, Mönchsgeier kreisten am Himmel, und an den bizarr geformten Felserhebungen kletterten Steinsperlinge, was will man mehr?

Julia holte uns (fast) wie vereinbart um halb 11 vormittags ab. Sie, eine gebürtige Ukrainerin, die es der Liebe wegen in diese Gegend verschlagen hat, entschuldigte sich immer wieder für die Verspätung. Als Ukrainerin sei sie sonst immer pünktlich, in Georgien dagegen sei Pünktlichkeit so eine Sache und man könne grundsätzlich immer dreiviertel Stunden Verspätung einrechnen. Für uns war alles ok, wir hatten bereits im Vorfeld abgemacht, erst nervös zu werden, sollte Julia bis um 12 nicht auftauchen… Im Besucherzentrum schnappten und beluden wir unsere Räder, stockten im nahen Geschäft unsere Vorräte auf und fuhren noch am selben Tag an die Azerbaijanische Grenze. Nach einem letzten Abend mit georgischer Gastfreundschaft wurde es Zeit, weiter zu ziehen. Der Vashlowani Nationalpark war definitiv ein würdiger Abschluss für unsere Zeit im äusserst abwechslungs- und spannungsreichen Georgien!
AZERBAIJAN

Wenn du in ein neues Land reist und 100 Meter vor der Grenzstelle kommt ein Schild, auf dem dir «Good Luck» gewünscht wird, kannst du dir ein Schmunzeln nur schwer verkneifen… Das Glück brauchten wir aber tatsächlich, schliesslich mussten wir an diesem Grenzübergang zum ersten Mal einen Passwechsel vornehmen. Unser Plan war, dass Roli die Erstpässe nach der georgischen Kontrolle verschwinden lässt und Selena die Zweitpässe am azerbaijanischen Zoll hervorzaubert.
Teil 1 funktionierte logischerweise super: Der georgische Beamte checkte in unseren Pässen den Einreisestempel, glich die Fotos mit unseren Gesichtern ab, und schon hatten wir unseren Ausreisestempel. Roli packte die Pässe und versteckte sie an einem vorbereitetet Plätzli seiner Lenkertasche.
150 Meter weiter fragte ein uniformierter Azerbaijaner nach unseren Pässen, Selena öffnete ihre Lenkertasche und drückte ihm unsere Zweitpässe in die Hand. Etwas gelangweilt blätterte er sie von vorne nach hinten durch, schaute uns an, blätterte sie nochmals von hinten her durch, stutze, dann die Frage: «Stamp?». Wir stellten uns blöd: «Stamp?» Der Grenzbeamte beharrte, nun eher feststellend als fragend: «No stamp!». Wir auch eher feststellend: «New passport! New passport!». So ging das einige Mal hin und her, doch schliesslich bekamen wir unsere Pässe mit einem Kopfschütteln zurück. Yes! Siegesgewiss radelten wir weiter und machten schon die ersten dummen Sprüche darüber, wie einfach das nun gewesen sei. Denkste!
Nach der nächsten Kurve kam eine grosse Zollstelle, mit Militärs, Polizisten, Beamten, Hunden… Man wies uns an, ganz rechts ranzufahren und wollte wiederum unsere Pässe und die Visa sehen. Nach kurzem hin- und her musste wir uns zu einem Schalter begeben, nun zu einem Beamten, dessen englischer Wortschatz weit über «Stamp?» und «No stamp?» hinausging. Er akzeptierte zwar, dass wir neu Pässe hätten, fragte aber hartnäckig nach unseren alten, und irgendwo müsse da ja der georgischen Stempel sein, sonst wären wir nicht hier. Zeit für eine Flucht nach vorne; Wir rückten unsere Erstpässe raus, erklärten den Beamten den Grund für unserer zwei Pässe wieder und wieder (gefühlte zehnmal…) und bekamen schlussendlich beide Pässe zurück, der Zweitpass nun mit Azerbaijanischem Einreisestempel. Uff! Obendrauf gabs dann den wirklich gut gemeinten Ratschlag, dass wir solche Verwirrungen bei der Einreise in den Iran unbedingt vermeiden sollten, da wir sonst mit grossen Problemen rechnen müssten. Danke, das werden wir uns sicher zu Herzen nehmen!
Schon wollten wir weiter, doch ein weiteres Mal wurden wir gestoppt. Ein Teil der Beamten interessierte sich nun für die Technik unserer Räder, ein anderer Teil entdeckte unsere Ferngläser und reichte sie dann an andere Beamte weiter, und ein dritter Teil schliesslich machte seinen Job und röntgte unser komplettes Gepäck durch. Neugier weckte da allerdings nur die Küchentasche, aber nachdem sich all die Fläschchen und Döschen als harmlose Gewürze herausgestellt hatten, durften wir nach gut einer Stunde am Zoll auch schon weiter. Welcome to Azerbaijan!

Unterwegs
Von den ersten Metern auf Azerbaijans Strassen merkt man, dass hier die Petroldollars sprudeln. Auf grösstenteils neuen, breiten und durchwegs topfebenen Strassen rollen wir mit unseren Rädern durch dieses Land im östlichen Kaukasus. Den Reichtum sieht man zwar den Dörfern und Kleinstädten auf dem Land in keiner Art und Weise an, aber an den grossen Verkehrsachsen sieht man, dass Geld für Infrastrukturprojekte durchaus vorhanden wäre.
Schnell wurde uns klar, dass wir hier noch viel enthusiastischer gegrüsst werden als in Georgien. Es wird gehupt, gewunken, einige lehnen sich sogar aus fahrenden Autos und rufen uns zu. Wer ein paar Brocken Englisch kann, schmettert sie uns entgegen: «Hello hello! Where you from? Drink tschai!». Manchmal halten Wagen an und die Leute wollen ein Foto mit uns machen, einmal drückt uns eine Frau im Schleier aus einem Auto heraus ein grosses Glas Feigen-Konfitüre entgegen, -wir sind (zumeist) entzückt. Ein Barbier, der Rolis Bart stutzt, weigert sich, dafür Geld anzunehmen. Per Google-Translater werden wir gefragt: «Wurdet ihr in unserem Land gut aufgenommen?», -klar ja!
Wir verstehen zwar nicht immer alle sozialen Codes und sind das eine oder andere Mal auch irritiert, wenn eine Gruppe Männer direkt neben uns steht und ganz offensichtlich über uns spricht, ohne uns aber direkt zu beachten, und die Nähe-Distanz-Regel ist hier teilweise extrem verkürzt (vor allem beim Anstehen in Geschäften oder an Schaltern), aber wir fühlen uns nie unwohl. Was auffällt ist, dass (zumindest auf dem Land) im Alltag nur sehr wenige Frauen zu sehen sind. Morgens um 10, wenn wir einkaufen, stehen dutzende Männer in Gruppen vor den Geschäften, nicht eine Frau weit und breit. Auch in den Geschäften und an den Strassenständen treffen wir praktisch nur auf Männer. Wir haben viele spannende Gespräche, immer mit Männern.
"Nebenstrasse" in Azerbaijan und Tarkan, der diesen noch Tag gerettet hat.
Tarkan
Einen dieser Männer lernen wir kennen, nachdem wir uns so richtig verfahren haben. Also eigentlich ja nicht verfahren, weil gemäss unserem Navigations-App hatten wir eine super Abkürzung gefunden. Tapfer durchquerten wir kleine Flüsse, trugen die Räder über Felsen und durch Bachbetten, umgingen gewaltige Schlammpfützen und glaubten bei jedem neuen Hindernis (man kanns ja auch als Challenge sehen), dass es nun wohl nicht mehr schlimmer kommen könne. Und lernten jedes Mal: Doch, es kann. Als wir schliesslich an einem fast zwei Meter tiefen Abgrund standen wurde klar; no way, umkehren ist angesagt.
Aus der Abkürzung wurde also ein kleines Martyrium, denn nun mussten wir ja all die Hindernisse (Challenge ahoi!) nochmals anpacken, einfach in umgekehrter Reihenfolge. Als Krönung verlor Roli beim Durchqueren eines Baches noch seine Sonnenbrille (schon die zweite seit dem Start), juhui! Zum Glück tauchte bei einem der schwierigsten Hindernisse plötzlich ein Mann aus dem Nichts auf und half uns, die Räder über einen Kanal zu hieven.
Wieder an der Strasse angekommen, meinte Roli zu Selena: «Wenn jetzt einer anhält und uns mitnehmen will, ich würde ja sagen!». Unglaublich, aber wahr: Kaum losgefahren, hielt neben uns ein Ford Transit an! Der Fahrer fragte gestikulierend, ob er uns mitnehmen solle. Wir, ohne zu zögern: «Yes!».
Von Tarkan lernten wir in den folgenden zwei Stunden vieles über Land und Leute, und einige Brocken Azerbaijanisch. Er, ursprünglich in Georgien aufgewachsen, sieht sich weder als Georgier noch als Azerbaijaner, sondern als Turk: ein Mitglied der Turkvölker. Bei einem Camp von Flüchtlingen aus dem Berg-Karabach-Konflikt hielt er an und lud uns zum Mittagessen ein; wir hatten diese Camps zwar schon ein paar Mal gesehen, ohne aber zu verstehen, was die Geschichte dahinter ist. Am liebsten hätte uns Tarkan direkt nach Baku mitgenommen, zeigte dann aber Verständnis dafür, dass wir die Sache mit dem Velo zu Ende bringen wollten.
Wir fahrn fahrn fahrn, auf der Autobahn
Azerbaijanische Strassen mögen zwar gut sein, aber das Strassennetz kann nicht als engmaschig bezeichnet werden. Zaghafte Versuche, Nebenstrassen zu nutzen, endeten durchwegs desaströs. Das bedeutete für uns, immer schön der Hauptstrasse zu folgen. Ein Blick in die Karte zeigte, dass die Hauptstrasse 130 Kilometer vor Baku zur Autobahn M4 wird. Zum Glück konnten wir bereits in Rumänien und Bulgarien Erfahrungen mit dem Befahren von Autobahnen sammeln, daher war das Motto: Einfach mal drauflos und dann schauen, wie der Verkehr auf uns reagiert.
Nach wenigen Metern wurde klar, dass die Strasse a) nigelnagelneu ist, b) zwei Spuren plus einen Pannenstreifen (Radweg!) hat und c) kaum befahren ist. Nach einigen Kilometern war unsere Seite gesperrt und der Verkehr wurde auf die entgegenkommende Spur geleitet, doch die netten Strassenarbeiter vor Ort bedeuteten uns, dass wir einfach auf unserer Seite weiterfahren sollten. So hatten wir auf den folgenden 15 Kilometern einen top ausgebauten, topfebenen Radweg ganz für uns allein, drei Spuren, acht oder sogar zehn Meter breit. Und auch danach blieb der Verkehr bis kurz vor Baku angenehm. Die Polizei schenkte uns genau so wenig Beachtung wie den gelegentlichen Traktorfahrern, die auf einer Autobahn ja eigentlich genau so wenig zu suchen hatten wie wir.

Thumbs up für die Stadtautobahn Baku!
Baku
Bevor wir in Baku unser Hotel aufsuchten, radelten wir schnurstracks in Richtung Kaspisches Meer. Wir wollten die Strecke durch die Kaukasusregion, die in Batumi begonnen hatte, symbolisch mit all unserem Hab und Gut beenden. Irgendwann sahen wir dann das Meer, aber eine achtspurige Strasse (die, wie wir später rausfanden, einmal pro Jahr als Formel 1 Strecke herhalten muss) versperrte uns den Zugang. Und wie wir so diese Strasse entlangfahren, hörten wir im ganzen Lärm plötzlich jemanden unsere Namen rufen: Ina und Bart, von denen wir uns fünf Wochen zuvor im Hafen von Batumi verabschiedet hatten, standen bei einer Statue und winkten uns zu! Unglaublich, wie klein so eine 2-Millionen-Stadt sein kann. Mit ihrer Hilfe fanden wir dann doch noch einen Weg zum Kaspischen Meer und konnten das Kaukasus-Abenteuer letztlich abschliessen. Ganz ehrlich; bei der Planung hat uns dieses Stück Bauchschmerzen bereitet. Wir wussten nicht, ob und wie wir diese anspruchsvolle Etappe mit all ihren Höhenmetern packen würden… Vielleicht würden wir uns hier eingestehen müssen, dass wir uns zu viel vorgenommen hatten. Aber nun war es geschafft, wir waren in Baku, checkten ins Hotel ein uns planten für die kommenden Tage einfach mal gar nichts.
Gar nichts gibt’s nicht, und natürlich hatten wir in Baku ein paar Besorgungen zu machen. Roli brauchte einen Ersatz für die verlorenen Sportbrille, und Selena machte sich auf die Suche nach ihrem Haaröl. Beides stellte sich als gar nicht so einfach heraus. Kein Brillen- oder Sportgeschäft in Baku hatte eine geeignete Brille, mit der Roli auch bei diffusen Lichtverhältnissen etwas sehen konnte, und auch die Marke von Selenas Haaröl war nirgends zu finden. Erst am dritten Tag stiessen wir dann doch noch auf eine passende Brille, und auch ein würdiger Ersatz für das Haaröl konnte schliesslich gefunden werden.
Am vierten Tag liessen wir uns vom Freund eines Freundes unseres Hotelreceptionisten 70 Kilometer Richtung Osten chauffieren, um den Abscheron-Nationalpark nach spannenden Vögeln abzusuchen. Hier, am östlichsten Zipfel Azerbaijans, entdeckten wir eine Rohrdommel, jede Menge Strandvögel und, -ganz, ganz viel Wind. Irgendwann wehte der so stark, dass wir und nur noch mit Mühe verständigen konnten. Schön wars trotzdem, wie wir da so über Muschelsand wanderten. Und der Gedanke, hier nur noch knapp 200 Kilometer Luftlinie von der turkmenischen Küste entfernt zu sein, befeuerte unsere Reiselust. Im nächsten Frühjahr werden wir, vielleicht, dort vorbeikommen…


Am letzten Abend in Baku gab’s etwas zu feiern: Seit drei Monaten unterwegs, gut ein Sechstel der Strecke geschafft! Wir gönnten uns ein azerbaijanisches Festmahl mit Plov, Dolmas, Granatapfelwein und einem Dessert aus mit Zucker überbackenen Käse («You have to try this!), den wir jetzt mal höflich als interessant bezeichnen wollen... Weniger interessant war dann die darauffolgende Nacht mit Durchfall, und so wurde aus den geplanten vier Tagen in Baku schlussendlich deren sieben. Das war aber gar nicht so schlimm; wir machten kleine Spaziergänge, entdeckten die eine oder andere schöne Ecke in Baku und genossen so tatsächlich mal drei Tage lang das erholsame Nichtstun.

Von Schlamm, Öl und nicht vorhandenen Küstenstrassen
Nach Baku führte unser Weg immer in Richtung Süden. Leider führte die Strasse nie direkt am Meer entlang, und so lagen noch ein paar Tage trockene, braune Landschaft vor uns. Wir «bestiegen» mit unseren Velos die legendären Schlammvulkane von Gobustan und hatten dort einige spannende Begegnungen mit Touristen aus China und Israel. Die Vulkane selbst sind eher lustig und interessant als imposant, aber da Azerbaijan 70 Prozent aller Schlammvulkane weltweit beherbergt, muss man die unbedingt besuchen, wenn man sowieso in der Gegend ist. Insbesondere bemerkenswert fanden wir eine sumpfige Pfütze ganz in der Nähe, an der die Taxis mit den Touristen achtlos vorbeifahren; es ist eine der wenigen Stellen, an der Erdöl offen an die Oberfläche drückt. Wir aber waren vom Schwarzen Gold angetan und verweilten ein paar Minuten. Erdöl. -Vielleicht der vielseitigste, gefährlichste und meist umkämpfte Rohstoff überhaupt. Hier lag er vor uns, und war eigentlich ganz schön, wie er so den wolkigen Himmel über uns in seinem tiefschwarzen Glanz spiegelte.

Weiter südlich lernten wir im Shirvan Nationalpark Hikmet kennen. Hikmet ist Ranger und mag Velofahrer. Aber noch viel mehr mag er Birder. Kurz: Hikmet mochte uns sehr. Da wir an diesem Morgen Schwierigkeiten hatten, frisches Trinkwasser und neue Vorräte zu besorgen, hatten wir eigentlich nur ein paar Nachmittagsstunden Zeit, um das grosse Schutzgebiet zu erkunden. An einem schilfumwachsenen See inmitten einer endlos scheinenden Steppenlandschaft sichteten wir Rosaflamingos, Purpursumpfhühner diverse Entenarten und, endlich!, -die lang ersehnten Krauskopfpelikane. Wir waren hin und weg. Als Hikmet uns anbot, unser Zelt auf dem Dach der Rangerstation aufschlagen zu dürfen, liessen wir uns nicht zweimal bitten und sagten für den nächsten Tag zu.
Am nächsten Morgen standen wir also pünktlich um Neun wieder im Park und richteten uns für die nächsten 24 Stunden ein. Ausser uns war noch ein Aufseher und zwei Tagesgäste aus Baku vor Ort. Ansonsten gabs nur uns, rudelweise Gazellen, Schlangen und jede Menge Vögel. Am Abend genossen wir einen herrlichen Sonnenuntergang, kochten Spaghetti und freuten uns über die Schleiereule, die fauchend ihre Runden um unser kleines Reich zog. Von allen bisherigen Zeltplätzen wird dieser eine nur schwer zu toppen sein.
Grün
Noch weiter südlich wurde die Landschaft um uns plötzlich wieder grün; wir hatten die subtropischen Küstenwälder des Kaspischen Meeres erreicht. Hier gibt es wieder alle paar Kilometer ein kleines Flüsslein, es wird fleissig Landwirtschaft betrieben, und die Luft wurde auf einmal so feucht, dass unsere Wäsche wieder länger als nur eine Nacht zum Trocknen benötigte. Wir richteten uns 30 Kilometer vor der iranischen Grenze für drei Tage in einem kleinen Guesthouse ein. Die Umgebung und die Räume erinnerten uns an ein kleines Chalet zuhause in den Schweizer Bergen. Passend dazu gab es endlich wieder mal Regen, und von so einem warmen Chalet aus betrachtet ist das eine schöne Sache nach ener Velotour durch die trockenen Landschaften Azerbaijans…
Poststelle im Grünen, mit Bahnanschluss und Meerblick
Ausreise auf Bürokratisch, Stufe 1
Nach einer letzten Nacht mit einem letzten Bier im azerbaijanischen Teil der Grenzstadt Astara wurde es Zeit, ein Land weiter zu ziehen. Man liest und hört sehr viel Gutes, wenn man sich auf eine Reise in den Iran vorbereitet. Die iranischen Grenzbeamten gehören aber definitiv nicht dazu. Und so fuhren wir angespannt und voller diffuser Erwartungen Richtung Zoll. Roli war tags zuvor sogar noch beim Barbier gewesen, um einen möglichst guten Eindruck zu machen…
Die Azerbaijaner nahmen ihren Job wie schon bei der Einreise seeehr genau. Wir wurden kurz befragt, unsere Pässe wurden gescannt, unsere Gesichter wurden mit den Fotografien verglichen, die bei der Einreise von uns gemacht wurden, und schliesslich durften wir die Velos wieder komplett entladen und alle Taschen durchs Röntgengerät schicken. Der Beamte hinter dem Monitor war zwar grade mit seinem Handy beschäftigt, aber egal; der Bürokratie war genüge getan. Schliesslich und schlussendlich bekamen wir unseren Ausreisestempel und wurden mit dem netten Hinweis, dass der Iran ein «really dangerous country» sei und wir bitte gut auf uns aufpassen sollten, aus Azerbaijan entlassen.
Dangerous country? -Hatte man uns genau das ein paar Wochen zuvor über Azerbaijan nicht auch schon gesagt?
IRAN
Der Iran. Für uns Liebe auf den zweiten Blick, seit dann dafür aber so richtig. Eine Geschichte mit Höhepunkten und Prüfsteinen, und einem unerwarteten Ende. Der nachfolgende Text ist länger als die bisherigen Reiseberichte, und wird Land und Leuten doch nur im Ansatz gerecht. Vieles haben wir weggelassen, um anderes ausführlicher erzählen zu können. Nicht genug erwähnt werden kann die grosszügige Herzlichkeit der Menschen. Wir haben bei unseren Reisevorbereitungen darüber gelesen, aber man glaubt es erst so richtig, wenn man sie selbst erlebt. Schwierig, dafür passenden Worte zu finden, ohne dass es kitschig wird. Am ehesten trifft’s für uns ein englisches Adjektiv: mindblowing.
An der Grenze zum Iran
Im Rückblick müssen wir über uns selbst lachen; Wir hatten die Velos vom gröbsten Schmutz befreit, den Staub von den Taschen gebürstet und deren Inhalt aufgeräumt. Rolis Haare wurden frisiert und der Bart gestutzt. Selena hat sich in iranischen Blogs zu how-to-wear-a-Hijab schlau und vor dem Hotelspiegel ein paar Trockenübungen gemacht. Die letzten Schlucke Rum im Expeditions-Flachmann wurden gewissenhaft der Vernichtung zugeführt. Alle Papiere, Visa, Versicherungsnachweise und die Pässe griffbereit im Lenkertäschli deponiert. -Und trotzdem war da, mehr als an den Grenzübertritten zuvor, eine diffuse Nervosität, als wir die kleine Brücke über den Grenzfluss querten. Auf der anderen Seite dann mehrere Gebäude und Menschengewimmel, wir bleiben kurz ratlos stehen, doch man weisst uns nach rechts, wo ein mit bunten Fähnchen geschmückter Plastikpavillon zu einem vergitterten Durchgang führt. Roli versucht mit der Bemerkung, dass ganze wirke wie der Eingang zu einem Goa-Festival, die Nervosität etwas zu glätten, scheitert aber. Schliesslich stehen wir vor einer Tür, über der das Konterfrei Chomeinis streng auf uns herunterblickt, stossen sie auf und schieben unsere Räder in einen Schalterraum.
Natürlich fallen wir sofort auf. Ein Beamter lächelt uns an, winkt zuerst uns und dann einem Kollegen zu. Dieser lotst uns zu einem der Schalter, setzt sich und sagt: «Welcome to Iran. Passports please.» Währendem Pässe und Visa elektronisch erfasst werden, wird die Schweiz als wunderschönes Land gelobt, man fragt nach unseren Reisezielen im Iran und sagt, dass Isfahan und Shiraz zu dieser Jahreszeit sehr angenehm sein sollen. Nach weiterem Geplauder erhalten wir alle Papiere frisch gestempelt zurück und der nette Herr wünscht eine gute und sichere Weiterreise.
Soweit, so gut. Weiter geht’s zur Gepäckkontrolle, wo zwei Beamte neben einem Röntgenband bereits warten. «Where are you from?», will man zur Begrüssung von uns wissen. «Switzerland? Ah! Bern, Basel, Luzern! Young Boys best Football-Team! Guten Tag, wie geht es ihnen?» Wir sind baff, und während wir mit einem der Beamten in einem Englisch-Deutsch-Mischmasch (ausgerechnet!) über Fussball plaudern, schickt der andere eine von unsere zwölf Tasche durchs Röntgengerät, ohne dabei den Monitor auch nur von der Seite her anzuschauen. Ist das alles? Auch hier wünscht man uns eine gute Reise, «Welcome to Iran!», -und weist uns freundlich den Weg nach draussen.
Im ersten Moment sind wir unsicher, ob wir jetzt wirklich alle Kontrollen geschafft haben und schauen uns um. Jede Menge Menschen. Strassenhändler. Rufe: «Taxi? Taxi!», oder: «Change Money, change Money?». Ja, ganz offensichtlich, wir sind im Iran. Wow!
Ankommen
Wer in den Iran reist, hat einige Dinge zu beachten. So ist zum Beispiel der Bezug von Bargeld oder das Bezahlen mit Kreditkarten für Ausländer nicht möglich. Man muss also das ganze Geld, das man zu benötigen glaubt, in Bar mit sich tragen. In Azerbaijan haben wir daher Dollars organisiert, und irgendwo ganz tief in unseren Taschen war noch ein Bündel Schweizer Franken gebunkert. Aus Blogs wussten wir, dass es einen offizielle und einen inoffiziellen Wechselkurs gibt. Banken und Klein-Gauner grad nach der Grenze versuchen, arglosen Iran-Neulingen Rials zum offiziellen Kurs anzudrehen. Dabei wird dann wichtig in den Handys rumgetippt uns den Leuten weissgemacht, sie würden jetzt grade ein super Geschäft machen. Dabei ist der offizielle Kurs etwas viermal schlechter als der inoffizielle, den alle Wechselstuben und Strassenhändler im Inland benutzen. Wir haben daher alle Strassenhändler (es sind viele..) ignoriert und das erstbeste Exchange-Bureau aufgesucht. Für 100 Dollar gabs 11 Millionen Rial. Phu! Soviel Geld… In der Wechselstube wurde uns beschieden, dass unsere Schweizer Franken, wenn überhaupt, in grossen Städten getauscht würden, aber sicher nicht hier. Ups… ob das noch ein Problem geben könnte?
Nachdem wir unsere sieben Sachen in einem Hotelzimmer in Sicherheit gebracht hatten, spazierten wir durch Astaras Lädeli-Zeile. Selena suchte ein Sport-Hijab und Roli schaute, wo man abends etwas essen könnte. Beides war nicht erfolgreich; die Buchsstaben an den Geschäften waren uns fremd und die Frage nach Sport-Hijabs löste bei den Verkäufern Befremden aus. Zurück im Hotel erhielten wir eine Nachricht von Ina und Bart, einem Deutsch-Niederländischen Paar, das gut eine Woche vor uns in den Iran geradelt ist. Beim Campen wurde ihnen nachts der Kocher aus dem Vorzelt gestohlen und zwei Tage später wurde das Zelt und diverse Teile von den Rädern weg entwendet. Die beiden waren von Deutschland nach Teheran unterwegs, und dass sie kurz vor dem Ziel gleich zweimal Pech hatten, tat uns unheimlich leid. Gleichzeitig gingen uns tausend Dinge durch den Kopf, auf was wir uns da die nächsten Wochen wohl einstellen müssten… Schliesslich entschieden wir uns, der aufkeimenden Paranoia keinen Raum zu geben, gingen nochmals nach draussen, kauften ein schickes Kopftuch, fanden einen klitzekleinen Kebap-Laden und verschlangen eine Portion Reis mit Schaschlik und Dough*. Der Preis von 350'000 Rials liess uns zwar kurz zusammenzucken, aber nach kurzem Nachrechnen fanden wir 3.50 Franken für einen ganzen Znacht mehr als nur ok.
Nach einer ersten Nacht im Iran wollte wir das etwas charme-arme Astara so rasch als möglich hinter uns lassen. Die Richtung war klar, immer weiter der Küste des Kaspischen Meers nach Süden folgen. Und da es dafür nur eine Strasse gibt, war die Planung der ersten Etappe relativ einfach.
Der Verkehr im Iran spielt in einer eigenen Liga, doch dazu später mehr. Wir lesen ja immer brav die Reisehinweise der deutschen und schweizerischen Behörden. Da bereits ab Ungarn vor dem Verkehr gewarnt wird, liessen wir uns von der Formulierung: «Das unberechenbare Verhalten vieler Verkehrsteilnehmer und die mangelhafte Wartung eines grossen Teils der Fahrzeuge … stellen ein hohes Unfallrisiko dar.», nicht aus der Ruhe bringen. Schon in den ersten Kilometern wurde uns aber bewusst, dass wir es hier mit einem neuen Mitspieler zu tun hatten: Motorräder! Knatternd und qualmend bahnen sie sich ihren Weg durch den Verkehr. Man sitzt auch mal zu zweit, zu dritt oder sogar zu viert darauf. Niemand trägt einen Helm. Verkehrsregeln, Geschwindigkeitsbeschränkungen und Signale werden, wenn überhaupt, maximal flexibel interpretiert. Konsequenz für uns: Bisher waren wir mit unseren breiten Velos die auffälligen Exoten im Strassenverkehr und wurden daher auch immer gut wahrgenommen, nun sind wir einfach ein weiteres Zweirädriges Etwas unter Vielen, das sich seinen Weg durchs Gewimmel sucht. Und im Gegensatz zu den Autos können Mopeds dich auch mal rechts überholen. Warum auch nicht, wenn da noch genug Platz ist?.. Ausserhalb der Stadt wurde es glücklicherweise rasch ruhiger. Stellenweise so ruhig, dass auf dem begrünten Mittelstreifen der Autobahn Kühe weiden können. So schön!
Die Gegend, eingeklemmt zwischen Meer und Gebirge, ist dicht besiedelt und wird landwirtschaftlich intensiv genutzt; keine guten Voraussetzungen für wildes Campen. Während der Mittagspause versuchten wir daher, uns das Schriftzeichen für Hotel bildlich einzuprägen. Gross war die Freude, als wir kurz Sonnenuntergang tatsächlich ein Schild mit dem passenden Schriftzug ausmachen konnten! Da aber nach 20 Minuten weder inner- noch ausserhalb des Gebäudes jemand auf unsere «Hallo?»-Rufe reagierte, gings noch ein Stück weiter. Im nächsten Ort hatten wir mehr Glück und wurden sehr freundlich empfangen, sogar unsere Velos bekamen ein Plätzli an der Wärme und so konnten wir einen entspannten Aufenthalt geniessen. Es gab nämlich viel zu tun: Unser Kocher wurde zunehmend unbrauchbar, und der Versuch, ihn mit azerbaijanischem Kerosin zu betreiben, hatte der Pumpen-Dichtung wohl den Todesstoss versetzt. Da die Aussicht, im Iran das passende Ersatzteil zu finden, gegen Null tendierte, musste die Dichtung in der Schweiz geordert werden. Das Paket würde zwischen 5-7 Arbeitstage unterwegs sein (bei 70 Franken Porto…). Also rechneten wir aus, wann das Paket abgeschickt werden könnte, welche europäischen und iranischen Arbeits- und Freitage berücksichtigt werden müssen, wie Kilometer wir pro Tag fahren wollen und welche Berge uns bei dem allem noch im Weg stehen. Die Quintessenz war: Wir und das Paket können’s in 11 Tagen nach Qom schaffen, einer mittelgrossen Stadt südlich der Hauptstadt Teheran. Teheran selber könnten wir so grosszügig umfahren.
Mit Hilfe der netten Dame an der Reception reservierten wir ein Hotelzimmer für das fragliche Datum und so kamen wir in den Besitz des letzten und wichtigsten Puzzleteils der ganzen Aktion: Eine Postadresse im Iran. Nun musste nur noch Rolis Vater informiert werden, der das Ersatzteil bereits besorgt und versandfertig verpackt hatte. Noch am gleichen Tag ging das Päckli in Brütten bei Winterthur auf die Post, wo noch alle Zollpapiere penibel ausgefüllt werden musste; nun hiess es: dem Paket eine gute Reise wünschen und Daumen drücken.
Erste Bekanntschaften
Wir radelten derweil weiter der Küste nach und machten in der Mittagspause zum ersten Mal a) mit der legendären iranischen Gastfreundschaft und b) mit der Aggressivität der lokalen Flora Bekanntschaft. An diesem schönen Stück Strand waren wir nämlich nicht die einzigen, sondern es waren viele Familien dort, die auf Decken sitzend das schöne Wetter genossen. Wir setzten uns etwas abseits auf eine kleine Düne und packten unseren Proviant aus. Schon nach wenigen Bissen steuerte eine junge Frau auf uns zu. Warum wir hier so abseits im Sand sässen, wollte sie wissen. Warum wir nicht einfach zu ihnen kommen würden, es hätte ja schliesslich Platz auf der Decke und genügend Essen dazu. Hmmm, darauf fiel uns tatsächlich keine schlaue Antwort darauf ein. Also stiessen wir unsere Velos durch den Sand zu einer Gruppe Menschen, die uns begrüssten wie alte Freunde, die man schon länger nicht mehr gesehen hat.
In den folgenden zwei Stunden lernten wir sehr viel über Land und Leute im Iran. Schon nach kurzem Kennenlernen konnten wir all die Fragen zu stellen, die uns auf der Zunge brannten: Ist es unhöflich, wenn ich mich barfuss auf deine Decke setze? Wie sagt man Danke? Darf ich wirklich nur die rechte Hand zum Essen nutzen? Und, und, und… Nur eine Frage wurde uns nicht schlüssig beantwortet: Warum ladet ihr uns Fremden ein, gebt uns Essen und Getränke und behandelt uns, als ob wir zur Familie gehören würden? Warum denn nicht?, -war die Antwort. Macht man das nicht so, dort wo ihr herkommt?
Schliesslich wurde es Zeit, weiterzugehen. Es folgte ein Abschiedsritual, wie wir es danach noch dutzende Male erleben durften: Habt ihr Instagram, WhatsApp? Gib mir deine Nummer, hier ist meine. Ruft an, wenn ihr etwas braucht, Probleme habt, jemanden zum Übersetzen braucht, egal was, egal wann! Nach vielen «cheili mamnuns» (vielen Dank) und langem Winken waren wir wieder zurück on the road. Wir fanden, wieder kurz vor der Dämmerung, ein kleines Hotel direkt an der Küste. Wir checkten für eine Nacht ein, und würden sechs bleiben.

Pause am Meer
Wir können viel Gutes über Azerbaijan sagen, und viele Vorurteile, die man im Netz findet, haben wir nicht so erlebt wie andere Traveller. Vor der miserablen Trinkwasserqualität wird aber wohl zurecht gewarnt. Zumindest kämpften wir immer wieder auf die eine oder andere Art mit unseren Verdauungssystemen. Es blieb aber immer an dem Punkt, wo wir uns noch darüber lustig machen konnten, so im Sinne von: «Hey, heute war’s nicht gar so arg wie gestern!». Bei Selena wurde es in den letzten Azerbaidjan- und den ersten Iran-Tagen dann aber doch dümmer und dünner, und als am Morgen des dritten Tages im Iran Fieber dazu kam, war definitiv eine Pause angezeigt. Gesagt, getan, wir informierten den Hotelbesitzer, dass wir für eine weitere Nacht bleiben würden. Zum nahen Markt wollten wir mit den Velos fahren, Vorräte aufstocken und, sicher ist sicher, Flaschenwasser einkaufen. In der Garage dann eine böse Überraschung: Drei von vier Pneus waren platt. Ein Blick auf die Reifen lieferte umgehend die Erklärung: Dutzende von grossen und kleinen Dornen hatten sich im Gummi verhakt und sich, Pannenschutzreifen hin oder her, bis zu den Schläuchen durchgearbeitet. Als Tatort kam eigentlich nur der Strand vom vorherigen Tag in Frage, dort waren uns stachelige Pflanzen aufgefallen. Der Ausflug wurde verschoben und stattdessen hiess es: Dornen entfernen und Reifen flicken im Akkord. Den Rest des Tages liessen wir ruhig angehen, schliesslich waren wir zum Erholen hier.
Die folgende Nacht stand unter keinem guten Stern, und am nächsten Morgen war Selenas Fieber auf über 39o angestiegen. Tagelanger Durchfall und plötzliches hohes Fieber; da waren wir mit unserer Reiseapotheke am Ende der Möglichkeiten angekommen und es wurde Zeit, professionelle medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Die Begriffe Hohes Fieber, Durchfall seit Tagen und Arzt auf Farsi reichten aus, um dem Mann an der Rezeption mitzuteilen, was los war. Nur Minuten später stand ein älterer Herr da, der Hotelier drückte ihm ein Bündel Geld in die Hand und erklärte uns mit Händen und Füssen, dass sein Freund Taxifahrer sei und uns zum nächsten Spital fahren würde.
Dort angekommen, wich uns der Taxifahrer nicht von der Seite. Er führt uns zum Empfang, füllte ein Formular aus, begleitete uns durch verwinkelte Gänge und brachte uns schliesslich zu einem Arzt, der ein paar Brocken Englisch verstand. Dieser hörte uns zu, schrieb ein paar Wörter auf ein Papier und verordnete Selena zum Abschied fünf Tage strikte Pause. Das Papier reichte unser Taxifahrer an eine Schwester weiter, die Selena drei Spritzen verpasste und eine Handvoll Kapseln aushändigte: Drei Pillen pro Tag, bis alle aufgebraucht sind. Aha, Antibiotika.
Auf dem Heimweg baten wir den Fahrer, kurz bei einem Lädeli zu stoppen und bei einem Strassenhändler kauften wir einen grossen Sack voll Mandarinen; Aufbaunahrung für die kommenden Tage. Zurück im Hotel dann die Rechnung für 40 Kilometer Taxi, Spitalgebühr, Medikamente, Einkäufe: 1,7 Millionen Rial, also knapp 16 Franken. Wir waren baff, aber noch mehr waren wir dankbar, dass uns so nett und unkompliziert geholfen worden war.
In den folgenden Tagen liess das Fieber mehr und mehr nach, Selena wurde von der Familie des Hotelbesitzers mit stärkenden Suppen verpflegt und Roli ernährte sich mangels Alternativen zur Hauptsache von Nudelsuppe und Mandarinen. Merke: Richtig gute Mandarinli bleiben auch dann lecker, wenn man davon 10 und mehr pro Tag verschlingt. Und das Beste daran: Der Tagesbedarf an Flüssigkeit ist damit auch schon zu einem guten Teil gedeckt. -Dank dem schlechten Wetter, Dauerregen und stürmische Winde, hielt sich die Trauer über die Zwangspause in erträglichen Grenzen.
Einzig die Idee, zeitgleich mit dem Ersatzteil-Päckli in Qom anzukommen, war nun mit den Velos nicht mehr realisierbar. Ein Plan B war rasch gefunden: Vom nächsten grösseren Ort aus einen Bus nach Rusht und dann nach Qom nehmen. Die Leute im Hotel erklärten uns, dass das schon möglich sei, es aber viel einfach wäre, einen Bus nach Teheran zu nehmen und von dort aus nach Qom weiterzufahren. Weil erstens: Egal, wo Du im Iran bist, es gibt immer einen Bus nach Teheran. Und zweitens: Wo auch immer Du hinwillst, von Teheran aus fahren mehrere Buse täglich genau in deine Richtung. Für uns hiess das: Wir wollten auf keinen Fall nach Teheran (Laut! Grau! Schlechte Luft! Chronisch verstopfte Strassen!), und genau dort führte uns unser Weg nun hin. Wenn schon, denn schon, -dachten wir uns, -und planten gleich drei Nächte ein. Ein wenig Kultur und: In der Hauptstadt würde sicher ein Händler zu finden sein, der unsere Schweizer Franken in Rials tauschen könnte. Die Leute vom Hotel unterstützen uns beim Kauf der Bustickets und beim Verladen der Bikes, und so sagten wir an einem bewölkten Vormittag dem Kaspischen Meer Lebewohl und liessen uns durch Küstenwälder, Gebirge und Wüsten zu der Stadt chauffieren, in die wir eigentlich nicht wollten.
Teheran
Zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs befand sich unser Bus etwa 20 Kilometer vor Teheran. Der Verkehr staute sich auf gezählten 11 Spuren, und das nur schon auf unserer Seite der Autobahn. Trotzdem: die Masse an Fahrzeugen bewegte sich erstaunlich rasch vorwärts. Wir waren je länger desto zufriedener damit, auf dieser Strecke im bequemen Bus und nicht mitten im Gewimmel auf unseren Sätteln zu sitzen. Als wir schliesslich die Endstation erreichten, war die Nacht bereits hereingebrochen. Dunkel war es trotzdem nicht, denn 8.5 Millionen Menschen produzieren mit all ihren Häusern und Geschäften und Autos und Motorrädern ja ganz schön viel Licht… Wir freuten uns, dass der Busbahnhof direkt neben dem Azadi Freiheitsturm lag. So konnten wir schon in den ersten Minuten eines der Wahrzeichen Teherans besichtigen, und das Ding sah, mit Halbmond auf klarem Himmel im Hintergrund, einfach super aus!
Dann hiess es, ein Hotel zu finden. Vom Turm bis zum Zentrum führt eine schnurgerade Strasse, die Orientierung sollte also schon mal kein Problem sein. Guten Mutes radelten wir los, und legten bereits nach wenigen Minuten, vor lauter Adrenalin breit grinsend, eine erste Pause ein. Um es mal mathematisch auszudrücken: Wir addieren den Verkehr aller Städte, die wir bis dahin erlebt hatten, multiplizieren das daraus entstehende Chaos hoch 3: Das ist Teheran. Während die meisten Autos sich einigermassen voraussehbar bewegen, sorgen Motorrädern für das totale Chaos. Sie bewegen sich in Fahrtrichtung, in Gegenfahrtrichtung, auf den Gehsteigen, schlängeln sich um Fussgänger, fahren auch mal quer zum Verkehrsfluss, mal schnell, mal im Schritttempo… Man muss auf tausend Eindrücke gleichzeitig achten, und dann doch so viel innere Ruhe bewahren, um sich auf seinem Fahrzeug einfach irgendwie durchfliessen zu lassen. Macht grossen Spass wenn’s klappt, ist aber auch super anstrengend und, da muss man realistisch sein, super gefährlich. Nicht umsonst liegt Iran in internationalen Statistiken über Verkehrsopfer seit eh und je auf den vorderen Rängen.
Nach knapp 11 Kilometern waren wir heilfroh, ein Hotel gefunden zu haben. Erschöpft wie nach einer mittelstrengen Tagesetappe checkten wir ein, assen in einem der unzähligen Food-Läden etwas Kleines und legten uns zufrieden in unsere Betten. Drei daumennagelgrossen Bettwanzen unter Rolis Kissen sorgten dann noch für eine kleine Zugabe, aber nachdem wir ein anderes, nun wanzenfreies Zimmer bekommen hatten, schliefen wir zufrieden ein.
Die folgenden zwei Tage waren die bisher grösste Überraschung unserer bisherigen Reise. Statt einem grauen Moloch lernten wir eine bunte, pulsierende und spannende Grossstadt kennen. Wir trafen auf viele weltoffene, grossherzige und hilfsbereite Menschen. Zwar tragen die Frauen auch hier ein Kopftuch, aber die Regeln dafür werden äusserst grosszügig interpretiert und eher als modisches Statement denn als religiöses Verdikt verstanden.
Trotz der ganzen Grossstadthektik nahm man sich Zeit für die beiden Touristen aus der Schweiz. Ali zum Beispiel erklärte uns nicht einfach den Weg zum nächsten English-Bookshop, sondern führte uns hin. Da wir dort nicht fanden, was wir suchten, begleitete er uns auch noch zum nächsten Geschäft; Mega!
Am zweiten Tag lernten wir in einem Outdoorshop Aryan und seine Freundin kennen. Die beiden begleiteten uns auf der Suche nach einem knielangen Hoodie für Selena in verschiedene Shops, luden uns schliesslich zum Essen ein, zeigten uns unterwegs schöne Parks, fuhren dann, da Selena das passende Teil noch immer nicht gefunden hatte, mit uns zum anderen Ende der Stadt in Einkaufszentrum, wo wir dann tatsächlich fündig wurden. Am Abend verabschiedeten wir uns wir alte Freunde voneinander.
Wir fanden aber auch Zeit für Museen, fanden den besten Kaffee seit Wien (hach…), und: Unsere Schweizer Franken wurden mit Freuden in Rials und Dollars gewechselt; zweiteres sogar zu einem deutlich besseren Kurs als in einer Schweizer Bank.
Ja, Teheran ist laut und grau, der Smog sucht seinesgleichen und der Verkehr ist jenseits von Gut uns Böse. Doch die Menschen darin setzen Farbtupfer, wo immer sich eine Gelegenheit dazu findet. Und solche gibt es in der iranischen Hauptstadt viele.
Die ganze Geschichte hatte nur einen einzigen Wermutstropfen: Wem auch immer wir von unseren Reiseplänen erzählte, immer kam: «Warum wollt ihr ausgerechnet nach Qom? Dort gibt es nur religiöse Fanatiker! Selena könnte als velofahrende Frau Ärger bekommen oder beschimpft werden! Sucht euch besser eine andere Route!». Gut zu wissen, aber: Unser Ersatzteil-Paket war unterwegs nach dorthin, also führte auch für uns kein Weg daran vorbei. Mit gemischten Gefühlen machten wir uns also auf den Weg dorthin, wieder per Bus.
Qom und der Heilige Schrein der Fatima
Für uns als westliche Touristen löst die Kombination der Begriffe Islam plus Iran plus Fanatiker nicht eben ein Feuerwerk an Vorfreude aus. Wir waren froh, dass wir zumindest schonmal ein Hotelzimmer reserviert hatten. Zur Not würden wir einfach dortbleiben und auf die baldige Ankunft des Pakets aus der Schweiz hoffen.
Tatsächlich sind auf Qoms Strassen die meisten Frauen dunkel verhüllt unterwegs, und gefühlt jeder zehnte Mann ist ein Mullah. Kein Wunder: In Qom befindet sich die grösste theologische Fakultät des Landes, an der auch der allgegenwärtige Chomeini einst lernte und später lehrte. Ausserdem befindet sich das zweitwichtigste Heiligtum der Schiiten hier, der Heilige Schrein der Fatima. Das unser Hotel in unmittelbarer Nachbarschaft dazu lag, realisierten wir erst, als wir davorstanden.
In der Lobby dasselbe Bild wie draussen: Die Leute waren klar religiöser gekleidet als in Teheran. Selena wartete draussen bei den Velos, und Roli war froh, ebenfalls konform (lange Hosen, lange Ärmel, geschlossene Schuhe) gekleidet zu sein. An der Reception dann das folgende Gespräch zur Begrüssung: «Ah, you’re from Switzerland? What a beautiful coutry!». «Thank you! Iran it’s also beautiful! We really like it!». «Really? You like it?». «Yes! The people, the food, the landscapes…». «Ah, yes, ok. But you have a good goverment, and we have a terrible goverment, they are all terrorists.» -Diese Aussage, in unterschiedlichen Formulierungen notabene, hörten wir im Iran dutzende Male. Aber in Qom zur Begrüssung im Hotel; damit hatten wir nicht gerechnet.
Nach dem Einrichten und einer Dusche spazierten wir durch die Stadt, wie immer auf der Suche nach neuen Eindrücken und etwas Feinem zum Essen. Bei beidem waren wir erfolgreich. Den Heiligen Schrein haben wir an diesem Abend grosszügig gemieden, immer noch verunsichert ob all den Warnungen in der Hauptstadt.
Als wir spätabends ins Hotel zurückkehrten, strahlte uns das Team an der Reception schon von Weitem an. Ob wir die aus der Schweiz seien? Da sei etwas für uns angekommen… überglücklich nahmen wir das Paket in Empfang! Das Ding schien einiges mitgemacht zu haben und sah arg lädiert aus, aber den Ersatzteilen und den zwei Tafeln Schoggi ging es super. Danke Papi! Endlich konnten wir wieder Tee und Kaffee kochen und uns abends ein eigenes Menu ins Zelt zaubern. Wie hatten wir das vermisst!
Der nächste Tag war ein Freitag, der muslimische Sonntag also. Ein lokaler Taxifahrer hatte uns am Vorabend erklärt, dass es keine gute Idee sei, den Heiligen Schrein am Freitag zu besuchen. Zu viele Pilger, zu religiös… Da wir das Paket hatten, sollte dies aber unser letzter Tag in dieser Stadt sein. Wir entschlossen uns, einfach mal in Richtung des Schreins zu spazieren; umkehren könnten wir ja jederzeit, wenn wir uns plötzlich unwillkommen fühlen sollten.
Schliesslich kamen wir unbehelligt auf einem grossen Platz an. Links von uns war der heilige Schrein der Fatima, ein Gebäude aus 1001 Nacht, das von einer gewaltigen, goldenen Kuppel gekrönt wird. Gläubige strömten in und aus dem Komplex, darunter viele Pilger aus Pakistan und Indien, die an ihrer speziellen Kleidung zu erkennen waren. Frauen dürfen den Schrein nur in einem Tschador (Ganzkörperschleier) betreten, und so gab es rund um den Platz dutzende Geschäfte, die fast ausschliesslich Tschadors in schwarz verkaufen. Wir hatten bis zu diesem Tag ja keine Ahnung, wie viele verschiedene schwarze Stoffe es für ein und dasselbe Kleidungsstück geben kann… Der Zugang zum Schrein ist streng kontrolliert, es gibt einen Zugang für Männer und einen für Frauen. Wir waren neugierig und überlegten kurz, für Selena einen Tschador zu kaufen und unser Glück zu versuchen. Doch Vernunft (für was will man denn das Ding nachher brauchen?) und Feigheit (die lassen uns eh nicht rein!) siegten gegen die Neugier. Auf der anderen Seite des Platzes gab es ja eine grossartige Moschee zu besichtigen, und das taten wir dann auch. Und überhaupt; All die Menschen in ihren schönen Festtags- und Pilgergewändern: Auch ohne Schrein gab es viel zu sehen.
Schliesslich hatten wir genug und machten uns auf den Heimweg. Neben dem Heiligen Schrein entdeckte Roli eine kleine Nebenstrasse, die nicht ganz so bevölkert war. Top Idee, um den Rummel hinter sich zu lassen. Doch schon nach wenigen Metern wurden wir von zwei Männern aufgehalten. Gestenreich machte man uns klar, dass wir hier nicht durchdurften. Offenbar gehörte die kleine Gasse zum Schrein. Noooo Problem!, meinten wir und wollten umkehren. Die beiden Männer bedeuteten uns aber, dass wir mitkommen sollten. Wohin? Einfach mitkommen. Roli versuchte mehrfach zu fragen, wo es denn hingehen soll? Keine Antwort, einfach mitkommen.
Schliesslich standen wir vor der Sicherheitskontrolle des Schreins. Wir sollten warten, five minutes!, ok? Ok. Die beiden Männer liefen in verschiedene Richtungen davon, und kehrten kurz darauf zurück. Einer hatte einen Tschador organsiert und hielt ihn Selena hin, der andere kam in Begleitung eines Mannes, der uns in bestem Englisch erklärte, er arbeite ehrenamtlich als Guide und würde uns beiden nun durch die Anlage führen. Selena wurde zum Eingang der Frauen geschickt und Roli zu dem der Männer. Bei der Kontrolle kurz die Frage: «You Muslim?» «No.» «Wellcome to Iran!», und schon war Roli drin. Auf Selena musste Mann dann etwas länger warten, aber man zwängt sich ja schliesslich nicht jeden Tag zum ersten Mal in einen Tschador. Die Führung war hochinteressant. Wir durften viele Fragen stellen und durften alles fotografieren. Die Frage, ob wir auch zum Grab der Fatima dürften, wurde zweimal höflich ignoriert, was wir aber voll ok fanden. Wir waren auch so schon mehr als zufrieden, was für eine Wendung dieser Tag genommen hatte. Die Iraner machen es einem wirklich leicht, sie zu mögen und ihre Kultur zu verstehen. Spätestens jetzt, nach dem lauten und liberalen Teheran und dem religiösen und doch so herzlichen Qom, hatten wir dieses Land ins Herz geschlossen und freuten uns, dass wir hier noch ganz viel Zeit eingeplant hatten.
On the Road again, endlich!
Nach 9 Tagen Pause freuten wir uns riesig, endlich wieder mit den Velos unterwegs zu sei. Auf den nächsten 300 Kilometern bis Isfahan würden wir über eine mehr als 2000 Meter über Meer gelegene Hochebene fahren, auf der nur noch vereinzelt kleine Städte und Dörfer liegen. Landschaftlich ein Augenschmaus. Die Sonne zog Tag für Tag ihre Bahn über einen wolkenlosen Himmel, und ein angenehmer Rückenwind erleichterte uns den Anstieg bis zum höchsten Punkt auf 2256 Meter. Die Tage wurden kürzer und kälter, um fünf Uhr nachmittags war die Sonne weg und die Sterne am Himmel. Sieht schön aus, war aber auch saukalt. In der zweitletzten Nacht vor Isfahan wurden wir dann von einer richtig brutalen Kältewelle überrascht: Es wurde so kalt, dass an Schlaf nicht mehr zu denken war. Es blieb uns nichts anderes übrig als zu hoffen, dass die Nacht schnell vorbeigeht. Tat sie natürlich nicht.
Am nächsten Morgen war unsere 2-Liter-Flasche mit Trinkwasser durchgefroren. Zum Glück hatten wir im Zelt noch eine Flasche, in der nebst Eis auch noch etwas Wasser in flüssiger Form war. So konnten wir immerhin Kaffee kochen und unsere Finger an den heissen Tassen wärmen. Die schlimmste Nacht der bisherigen Reise, und das mit Abstand. Für weitere Eis-Nächte mussten wir unbedingt eine bessere Strategie finden…
Isfahan
Schliesslich erreichten wir Isfahan. Wer in den Iran reist, kommt an dieser Stadt nicht vorbei. Und das aus vielen Gründen.
Wir fanden eine gute und preiswerte Unterkunft, quartierten uns ein und genossen drei Tage lang das typische Touri-Programm mit Sightseeing, Bazar, gutem Essen und Flanieren am Fluss. Als Highlights darf man sicher den Meidan-Platz, die 33-Bogen-Brücke und die Armenische Kirche hervorheben. Hach, und unseren allerersten Graufischer (ein Verwandter des Eisvogels) haben wir hier gesehen! Und Safran-Tee getrunken, mmmmmmhhh…
In Teheran hatte man uns gesagt, dass sie Leute im Isfahan, Yazd und Shiraz noch gastfreundlicher seien als die Teheraner, und das war nicht gelogen. Wo wir auch hinkamen, wurden wir in kurze Gespräche verwickelt, man führte und in die Symbole der Teppich-Kunst ein und erklärte uns alte Handwerkstechniken. Das Kaufen einer iranischen SIM-Karte war einfacher als gedacht (Internet ahoi!), und nach drei Tagen bereiteten wir uns auf die Weiterreise mach Yazd vor. Es wurde nämlich Zeit, unser 30-Tage-Visum um weitere 30 Tage zu verlängern, und das sollte dem Hörensagen nach in Yazd besonders einfach sein.
Von Isfahan führen zwei Routen nach Yazd. Eine folgt dem Highway und wurde uns mehrfach von Einheimischen empfohlen. Die zweite führt plusminus geradewegs an einem Salzsee vorbei durch eine Wüste, über ein kleines Gebirge mit einer alten Karawanserei und dann wieder runter nach Yazd. Klarer Fall: Variante zwei.
Am Tag der Abreise wurde das Land von schweren Unruhen erschüttert. Über Nacht wurde Benzin dreifach teurer und für gewisse Fahrer rationiert. Wie so etwas ausgerechnet im Iran, dem weltweit sechstgrössten Erdölproduzenten, passieren kann, ist und bleibt ein Rätsel. Plötzlich waren überall Polizisten im Kampfmontur, eine schwarze Rauchsäule stieg über Isfahan auf, Gerüchte über Verhaftungen und Schüsse machten die Runde. Der Staat stellte flächendeckend das Internet ab. Jeder hatte etwas gehört, niemand wusste etwas Genaues, aber alle blieben erstaunlich ruhig. Abwarten und Tee trinken… die Menschen im Iran erleben immer wieder Krisen, man lernt offensichtlich, damit umzugehen.
Auf abenteuerlichen Pfaden unterwegs nach Yazd
Für uns bedeutete das abgestellte Internet zum Beispiel, dass wir keine Wettervorhersagen mehr hatten. Aus den Prognosen der letzten Tage wussten wir, dass wir mit giftigem Gegenwind rechnen mussten, mit nachlassender Tendenz.
Die erste Nacht durften wir bei Abbas und seiner Familie übernachten. Wir bekamen einen feinen Znacht und später zeigte man uns noch einen ehemaligen Taubenturm, in dem nun Shishas geheizt werden. Die Taubentürme hatten einst eine grosse Bedeutung für die Landwirtschaft der Region. In jedem der Türme müssen tausende Tauben gewohnt und genistet haben. Den dabei in Massen anfallenden Kot wurde dann als Dünger benutzt. Eine Win-Win-Situation wie sie im Buche steht. Heute zerfallen diese Türme, denn auch im Iran wird mit chemisch hergestellten Turbodüngern mehr Ertrag erwirtschaftet als in der guten alten Zeit durch Taubenscheisse.
Die nächsten beiden Nächte verbrachten wir in Varzareh, einer Kleinstadt am Rande der Wüste. Wir wanderten auf Dünen, kosteten von der weissen Kruste des riesigen Salzsees und lernten ein paar nette Traveller aus Deutschland kennen, die sich auch hierhin verirrt hatten. Am vierten Tag nach Isfahan schien uns das Wetter stabil genug, um die nun folgende Etappe in Angriff zu nehmen. Für die nächsten gut 120 Kilometer würde nämlich nix kommen. Kein Dorf, kein Lädeli, kein Brunnen. Wenn wir wie geplant pro Tag 60 Kilometer schafften, würden wir eine Nacht bei der stillgelegten Karawanserei und die zweite schon in einem kleinen Bergdorf übernachten können.

Die ersten 30 Kilometer ging es bei leichtem Gegenwind zügig vorwärts, aber bis zur Karawanserei würde wir richtig ranhalten müssen. Nach einer kurzen Mittagspause gings also weiter. Der Wind wurde stärker und stärker, und irgendwann hatten wir einen richtigen Sturmwind gegen uns. Zum Umkehren war es zu spät, aber die Landschaft um uns bot nirgends auch nur ein Minimum an Windschatten; also kämpften wir uns weiter. Ein wenig hofften wir, dass ein Kleinlaster uns bis zur Karawanserei mitnehmen könnte, aber wir blieben an diesem Tag alleine in dieser abgelegenen Landschaft. Letztendlich schafften wir in drei Stunden knapp zehn Kilometer, dann war unsere Energie weg und es wurde dunkel. Mangels Alternativen stellten wir unser Zelt inmitten einer leeren Ebene in den Sturm. Nun wurden die in den letzten Monaten gesammelten Erfahrungen beim Lageraufbau erstmals einer echten Prüfung unterzogen: Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, und das Zelt würde auf Nimmerwiedersehen mit dem Sturm verschwinden.
Kurz, nachdem das Zelt stand, prasselte ein Eisregen nieder. Wir waren froh, dass wir uns beim Zelt für ein zwar etwas schweres, dafür umso stabileres Modell entschieden hatten. Trotz der brüllenden Winde schliefen wir nach einem kalten Znacht bald erschöpft ein. Irgendwann brach der Sturm wohl zusammen, zurück blieb eine tiefe Stille und am nächsten Morgen waren die Berge am Rande unserer Hochebene weiss gezuckert. Wunderschön.

Nun mussten wir Kilometer gutmachen. Nach einem guten Zmorgen, Haferbrei mit Trockenfrüchten und Kaffee, fuhren wir weiter. Die Karawanserei erreichten wir kurz vor Mittag. Spätestens dort wurde klar, dass der Schnee die erdige Piste soweit aufgeweicht hatte, dass wir nur langsam vorwärtskommen würden. Auch das zweite Tagesziel war also nicht wie geplant zu erreichen.
Die Fahrt durch die Wintermärchen-Landschaft war so zauberhaft, dass wir unsere Routenwahl trotz Sturm, Schnee und Matsch keinen Moment bereuten. Für die Nacht würde sich schon eine Lösung finden, zur Not würden wir nochmals campen und hoffen, dass es nicht all zu kalt würde. Am späten Nachmittag kam uns ein Auto entgegen. Der Beifahrer konnte gut English und lud uns ein, bei ihm und seinem Freund zu übernachten. Bis zur nächsten Siedlung seien es noch 7-8 Kilometer, aber dort gäbe es nichts, wo wir übernachten könnten. Wir hatten in dem Moment aber keine Lust, umzukehren und den beiden zu folgen, daher entschieden wir, uns weiter durch den Matsch zu kämpfen. Nicht die beste unserer bisherigen Entscheidungen. Beim Eindunkeln hatten wir die Siedlung nämlich noch bei Weitem nicht erreicht. Aber die Strasse war nun immerhin wieder befestigt, und in einiger Entfernung sahen wir das Werksgelände einer Bergmine. Kleine Laster fuhren von dort los, und wir hofften, dass uns einer von ihnen mitnehmen könnte.

Tatsächlich schafften wir es, einen zu stoppen. Ob er uns nach Nadushan fahren könne? Der Fahrer versuchte uns etwas zu erklären und wirkte nicht wirklich begeistert, aber in dem Moment hielt ein kleiner Wagen neben uns. Der Mann, der uns eine Stunde zuvor einladen wollte, war umgekehrt, weil er sich um uns Sorgen machte. Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Lastwagenfahrer durften wir unseren ganzen Karsumpel auf die Ladefläche hieven, stiegen in den kleinen Wagen und wurden nach Nadushan gebracht.
Unser Fahrer stellte sich als Mehdi vor. Der kleine Laster würde kurz vor Nadushan abbiegen müssen, aber von dort aus sei es nicht mehr weit bis ins Dorf. Er würde uns helfen, eine Bleibe für die Nacht zu finden. Er habe sich schon gedacht, dass wir es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen würden, daher sei er umgekehrt und wolle uns nun helfen. -Da war sie also wieder, diese unglaubliche Hilfsbereitschaft Fremden gegenüber. Eine gute Stunde später sassen wir in einer warmen Stube in Nadushan und schlürften heissen Tee. Mehdi verabschiedete sich, gab uns seine Nummer und meinte, wir sollten uns bei ihm melden, wenn wir in Yazd seien und irgendetwas bräuchten. Die Nacht in Nadushan war sehr erholsam, und das Frühstück lieferte genug Energie für die 90 Kilometer nach Yazd. Auf einer perfekten, stetig leicht abfallenden Strasse kamen wir gut voran und erreichten die 5000 Jahre alte Stadt inmitten der Wüste weit vor dem Sonnenuntergang.

Yazd, und eine überraschende Wendung
Die ganze Innenstadt von Yazd ist UNESCO-Weltkulturerbe. Unser Guest-House lag mittendrin, und so lag das Sightseeing direkt vor der Tür. Die Stadt besteht aus hunderten oder gar tausenden von verwinkelten Gassen. Alles scheint von aussen braun und trostlos, doch wo immer man eine Türe öffnet, erwartet einem eine Überraschung. Schöne Innenhöfe, Teehäuser, Gärten mit kleinen Teichen… Die Räume sind so angelegt, dass man im Sommer immer ein schattiges Plätzchen findet. Überall sind noch sogenannte Windtürme in Betrieb, die im Sommer für ein kühles Lüftchen in den Gebäuden sorgen. Man sieht der Stadt an, dass sie eine uralte Geschichte in sich trägt, und doch hat sie nichts Museales an sich.
Unsere Visa wurden ohne Probleme verlängert. Es ist ein wenig Papierkrieg und man braucht etwas Geduld mit den Beamten (und diese wohl mit uns), aber nach einem Tag warten, hatten wir die 30-Tage-Verlängerung in der Tasche. Nun ging es an die Planung bis zur Überfahrt nach Dubai. Die Zeit war knapp, aber mit etwas Glück konnten wir die Route über Shiraz zur Fähre in Bandar Abbas in gut drei Wochen schaffen. In Shiraz wollten wir unbedingt Persepolis besuchen, eine der bedeutendsten archäologischen Ausgrabungsstätten weltweit.
Und so machten wir uns am Morgen des 26. November 2019 auf den Weg nach Shiraz. Kaltes Wetter und Schnee erwarteten uns in der Höhe, doch nach Shiraz würden wir endlich auf sommerliche Temperaturen stossen. Das motiviert.
Auf dem Weg aus der Stadt werfen wir noch ein paar Postkarten ein. Vom Strassenrand ruft uns jemand zu. Zwei Velofahrer aus den Niederlanden, wie wir auf dem Weg nach Shiraz. Ob wir ein Stück zusammenfahren wollen? Klar! Roli voraus, dann Selena, dann die Holländer schlängeln wir uns durch den Verkehr. Direkt vor Roli schiesst ein Auto von Rechts in den Verkehr, Roli bremst ab, Selena schaut im selben Moment in den Rückspiegel, touchiert seitlich Rolis hintere Tasche, -und stürzt.

Bad News
Der Verkehr stoppte, Autofahrer und Fussgänger eilten zur Hilfe, Selenas Rad wurde von der Strasse runtergeschafft. Nachdem sie selbst auch auf dem Trottoir war, wurden sie von Leuten umzingelt: «Ambulanz? Ambulanz?». Zwar spürte sie sofort, dass etwas in ihrem linken Ellenbogen nicht mehr so war, wie es sein sollte, aber: Stürze auf den Ellenbogen können sehr schmerzhaft sein, Stichwort Narrenbein… Nachdem klar war, dass Arm, Hand und Finger mit viel gutem Willen noch in die allermeisten Richtungen bewegt werden konnten (-was rückblickend nur schon beim Schreiben dieser Zeilen schmerzt...), entschieden wir uns, erst mal abzuwarten. Wir könnten ja auch noch Morgen nach Shiraz starten, und das Guesthouse, indem wir die letzten Tage gewohnt hatten, war «nur» knapp zwei Kilometer entfernt. Also schoben wir unsere beiden Lastesel zurück zum Guesthouse, wo wir uns wieder im selben Zimmer einquartieren konnten. Auf dem Bett sitzend streiften wir dann endlich vorsichtig den Ärmel vom Ellenbogen. Kein Blut, aber der Anblick war nicht schön: Ab in Spital!
Nach der Ankunft im Notfall der Klinik Yazd ging alles sehr rasch. Kurze Aufnahme (Name, Geburtsdatum und Geschlecht reichten), ein Bett wurde zugewiesen und schon bald stand ein Pfleger da, der nach einem kurzen Blick auf den Arm ein einziges Wort sagte: «Dislocated.», -und wieder verschwand. Bald tauchte er wieder auf, nun mit Verstärkung. Eine Infusion mit Schmerzmittel wurde gelegt und ein älterer Arzt, wahrscheinlich Chef der Notfallaufnahme, machte sich tastend, drückend und murmelnd am Arm zu schaffen. Sein erster Kommentar: «Not dislocatet!». -Huch!, da waren wir aber froh. Nach eingehender Untersuchung von Schulter, Kopf, Hüfte und Hand wurde ein Röntgen und schliesslich noch eine Computertomographie angeordnet. Wir waren positiv überrascht, wie effizient hier gearbeitet wurde, und die Gerätschaften waren durchwegs modern. Einfach die etwas einsilbige Kommunikation war frustrierend und wir waren nie sicher, ob wir richtig verstanden, was man uns zu sagen versuchte. Schliesslich zogen wir den Telefonjoker und riefen auf gut Glück Mehdi an, der uns ein paar Tage zuvor schon einmal «gerettet» hatte. Mehdi übersetzte dann nicht nur per Telefon, sondern liess alles stehen und liegen, war 15 Minuten später bei uns und coachte uns durch die nächsten Gespräche. Nach einem weiteren Röntgen wurde schliesslich eine Gipsschiene angepasst, sodass der Arm fürs Erste entlastet war.
Am Ende hatten wir den Befund Haarriss an der Elle und, ganz wichtig, keine Operation notwendig! Das freute uns in diesem Moment riesig! Heute wissen wir allerdings, dass wir da etwas falsch verstanden hatten und was der Arzt tatsächlich meinte. Nicht: Keine Operation, sondern: Keine Operation heute. Jemand drückte uns eine CD mit allen Röntgen- und CT-Bildern in die Hand, und auf einem Zettel erhielten wir den Namen eines Orthopäden, bei dem wir uns am nächsten Tag melden sollten.
Zum Schluss wollte Roli dann noch wissen, wie man denn hier bezahlen könne? Zur Sicherheit hatte er 200 US-Dollar und ein Bündeli Rial-Noten eingesteckt, befürchtete nun aber, damit nicht sehr weit zu kommen. Pflegepersonal, zwei Ärzte, Infusion und Medikamente, zwei Röntgen, eine Computertomographie, Gipsschiene, Verbandmaterial… Das würde teuer werden! Es wurde ein Papier ausgedruckt, mit dem er zu einer Kasse beim Haupteingang gehen sollte. Dort dann der Schock: 2.8 Millionen Rial! Das sind... moment, -meinte der wirklich Rial, nicht viel eher Toman? "Toman?", "No, Rial!". Umgerechnet knapp 26 Franken. Verrückt: Dafür bekommt man Zuhause noch nicht mal einen Händedruck des zuständigen Arztes.
Am Abend besprachen wir dutzende Möglichkeiten, wie es nun weitergehen könnte. Ein Haarriss an der Elle bedeutete mit grosser Sicherheit, dass Selena die nächsten Tage oder Wochen nicht aufs Velo sitzen sollte. Wir könnten mit dem Bus in den Süden, dem Arm am Meer eine Pause gönnen, Vögel beobachten, dann wie geplant durch den Oman radeln und Persepolis im Februar besuchen. Oder, falls ein kleiner Eingriff nötig wäre, die Velos in Yazd lassen, zwei Monate per Bus durch den Oman reisen und dann am Ende des Winters von Yazd aus weiterradeln. Oder...
Wir waren trotz des Zwischenfalls vor allem erleichtert, dass es "nur" der Arm war, dass nichts Schlimmeres passiert war. Wir hatten Gebirge mit steilen Abfahrten hinter uns, hatten uns durch das Verkehrschaos mehrerer Grossstädte treiben lassen, begegneten unterwegs ungezählten Auto- und Lastwagenfahrern, die am Handy rumfummelten statt auf den Verkehr zu achten. So weit, so gut. In anderthalb Jahren on the road kann so etwas passieren, und nun war es halt passiert. Mit dem Schicksal haderten wir desswegen nicht.
Von den Türmen des Schweigens und einer schweren Entscheidung
Am nächsten Tag suchten wir den Spezialisten auf. Nach einer mittleren Odysee durch die Gänge des Yazder Klinikums landeten wir in einem kleinen Sprechzimmer. Vor einem Computer sass ein älterer Mann in weissem Kittel, ein gutes dutzend Assistenzärzte bildeten eine Traube um ihn und schauten uns erwartungsvoll an: Salam! Nachdem die Herkunftsfrage geklärt war, drückten wir jemandem die CD mit den Röntgenbildern in die Hand, worauf sich der Chefarzt unter den neugierigen Blicken aller Anwesenden am Computer zu schaffen machte. Nach wenigen Klicks und einem tiefen Schnaufer war seine Diagnose eindeutig: «Surgery needed!» Einer der Assistenzärzte sprang als Dolmetscher ein: Die Operation könne hier oder in der Schweiz durchgeführt werden, das hänge halt auch davon ab, wann wir nach Hause fliegen würden.
Wir wechselten einige vielsagende Blicke und erklärten unsere Situation: Eigentlich fliegen wir erst in mehr als einem Jahr nach Hause. Irritiert wiederholte der junge Arzt seine Frage, wann wollten wir genau zurückreisen? Nach erneutem Erklären wurde der Ärzteschar klar, dass wir auf grosser Reise sind und eine Operation unsere Planung ziemlich durcheinanderwirbeln würde. Was eine Operation bedeuten würde, wollen wir wissen. «Screws, nails, long rest!», antwortete der Chefarzt. Oje, genau diese Antwort wollten wir eigentlich nicht hören. Unser Plan, den Ellbogen einfach ein paar Wochen an der Küste zu schonen, war somit zur Makulatur geworden. Man versicherte uns, dass wir den Eingriff bedenkenlos vor Ort durchführen könnten, man sei für solche Geschichten bestens ausgerüstet. Der junge Arzt, der gedolmetscht hatte, schrieb uns seine Handynummer auf einen Zettel und bot uns an, ihn bei Fragen jederzeit kontaktieren zu dürfen.
Wir verliessen das Krankenhaus und besorgten uns im Medical-Store gegenüber der Klinik für vier Franken eine Armschlinge als erste Entlastungsmassnahme. Schnäppchenpreis. Im Hotel dann zuerst grosse Ratlosigkeit. War eine OP unbedingt notwendig? War nicht von einem Haarriss die Rede? Was würde eine OP bedeuten, wie lange müssten wir aufs Radeln verzichten? Schliesslich kam uns die Idee, weitere Meinungen einzuholen, und so schickten wir Röntgenbilder und CT unter Zuhilfenahme von ganz viel Vitamin B an zwei Ärzte und einem Röntgenzentrum in der Schweiz. Die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht war ja doch nur eine kleine Pause notwendig.
Während wir auf die Antworten warteten, lenkten wir uns mit einem Besuch der Türme des Schweigens ab. Diese Türme dienten als Grabstätte der Zoroastrier und wurden für Himmelbestattungen genutzt. Im Zoroastrismus ist es von grosser Bedeutung, dass die Leichname in den Himmel übergehen und nicht mit dem Erdreich und den Bodentieren in Berührung kommt. Was liegt da näher, als die Verstorbenen auf einer erhöhten Plattform den Vögeln zu übergeben, die die Körper dann Stück für Stück davontragen...
Es muss, als die Türme noch genutzt wurden, von Geiern und Krähen nur so gewimmelt haben. Klingt verrückt, war aber hier lange Zeit üblich. Erwähnt werden muss, dass es nur einer kleinen Kaste gestattet war, die Türme des Schweigens zu betreten und dem grausigen Festschmaus der Geier beizuwohnen. Die Angehörigen selbst übergaben diesen Priestern ihre verstorbenen Angehörigen am Fusse des Hügels und verabschiedeten sich so von ihnen. In den 70er-jahren ist diese Bestattungsform schliesslich verboten worden, und die Zoroastrier bestatten nun ihre Liebsten in Betonsärgen am Fusse des Hügels. -Auf dass sie nicht mit dem Getier der Erde in Berührung kommen mögen.

Organisieren, organisieren, organisieren
Am nächsten Tag hatten wir zwei Zweitmeinungen aus der Schweiz, und diese waren sich in der Sache einig: Kein Harrriss, sondern komplexer Bruch. OP zwingend. Keine Ahnung wie´s den lieben Sehnen geht, daher: Rückreise in die Schweiz wäre das Beste. Pffft! Obwohl wir bereits eine Vorahnung gehabt hatten, war diese Einsicht doch ein herber Schlag in die Magengegend. Frustrierend, wenn man bedenkt, wie weit wir es geschafft hatten. Dennoch war vom ersten Moment an klar: OP und Kurieren in der Schweiz, dann geht’s weiter. Wir spielten zweihundert Varianten auf einhundert Zettelchen durch: wie-was-wer-wann-wo-mit-wem?, -aber schliesslich war der Plan gefasst: Roli begleitet Selena in die Schweiz und fliegt Ende Dezember wieder in den Süden, um Max und Martin zu treffen. Der Besuch der beiden war seit Monaten geplant und es wäre schade, wenn das nicht klappen würde. Das hiess allerdings, dass Selena solange wie nötig ohne Roli in Zürich bleiben und später nachreisen würde.
Nun begann ein wahrer Organisations-Marathon. Schliesslich hatten wir einen ganzen Haushalt auf insgesamt 12 Velotaschen und -täschli verteilt dabei, die wir nun auf zwei Reisekoffer plus Handgepäck verteilen mussten. Ganz konkret: Zwei Gepäcksstücke unter 20 Kg, zwei Handgepäck à 8 kg. Unsere Lenkertaschen konnten wir , Bonus!, direkt auch als Handtasche nutzen. Dazu zwei Velos. Und: Für den Transport hatten wir nur 3 gesunde Arme zur Verfügung.
Nun hiess es, Flugpläne studieren, Gepäcklimiten abchecken, Busverbindungen nach Teheran suchen... Dabei kam uns die fabulöse Idee, dass wir Selenas Velo einfach im Iran lassen könnten. Das würde nicht nur Kraft und Kosten sparen, sondern wir könnten dann Ende Februar unsere geplante Route von Teheran her wieder aufnehmen. Selena würde Ende Januar zu Roli fliegen, der dann bereits im Oman wäre. Mit Bus und Zug würde man dann gemeinsam die Highlights des Omans und Südiran bereisen. So hätte der Arm auf Sicher genügend Zeit, um zu genesen.
Und so chatteten wir unseren Teheraner Freund Aryan an, um zu fragen, ob wir das Velo bei ihm einlagern könnten. Seine Antwort: «Nooooo Problem! Und ich kenne da jemanden in Yazd, der euch bei eurer Situation helfen kann: Kofferkauf, Ticketkauf für die Busfahrt, egal was! Hier ist seine Nummer.» Kurz darauf erhielten wir eine neue Message von Aryan, in der uns schrieb, dass er seinem Freund nun unsere Nummer gegeben hätte. Ok, auch gut.
Keine fünf Minuten später ploppte eine Nachricht auf Rolis Handy auf:
Dear Roland, hi! How are you? I´m Ehsan.
Hi Ehsan!
Where are you? I'm in Aqda.
We´re sitting right now in a restaurant, can we text in 30 minutes?
Yes, of course.
Thank you!
You‘re welcome!
Aqda ist mehr als hundert Kilometer von Yazd entfernt, und so schreiben wir Ehsan eine gute halbe Stunde später, dass wir uns freuen von ihm zu hören und dass unser grösstes Problem im Moment sei, wie wir das ganze Gepäck zum Busbahnhof bringen könnten. Ob er in Yazd jemanden mit einem Pickup kenne?
Hi my friend. Yes. I´m driving now, will be in 2 hours in Yazd.
Ehsan taucht also sozusagen aus dem Nichts in unserem Leben auf und nahm sich dann ganze zwei Tage Zeit, um uns bei allem Möglichen zu unterstützen. Er fuhr mitten in der Nacht 100 km von seinem Wohnort nach Yazd, musste sich das Auto von seinem Vater ausleihen, übernachtete bei seinem Bruder und spannte dessen Frau ein, die mit einem weiteren Auto unser Gepäck zur Busstation brachte. Er handelte auf dem Basar einen guten Preis für die beiden Koffer aus. Organisierte und bezahlte die Bustickets nach Teheran. Wir bedankten uns immer wieder für für seine bedingungslose Hilfe und fragten ihn irgendwann, warum er das eigentlich mache, schliesslich seien wir Fremde für ihn? Etwas irritiert antwortete er: Es gäbe nichts zu danken! Wir seien schliesslich Freunde von seinem Freund Aryan, also seien wir auch seine Freunde. Und Freunde helfen sich!
Im Partybus nach Teheran
An einem Sonntagmorgen machten wir uns schliesslich auf den Weg zum ausserhalb der Stadt gelegenen Busterminal. Selena fuhr mit Ehsans Schwägerin und dem ganzen Gepäck im Auto, Ehsan und Roli setzten sich auf die Velos und legten die gut 15 Kilometer mit Muskelkraft zurück. Es würde ein langer Tag werden! 9 Stunden Busfahrt über 700 Kilometer iranischen Asphalt, Ankunft in Teheran, dann Treffen mit Aryan... Der Abschied von Ehsan fiel uns nicht leicht. Obwohl wir uns erst seit zwei Tagen kannten, war es, als ob wir uns von einem alten Freund verabschieden würden. Wir versprachen, ihn in ein paar Monaten zu besuchen. Er würde uns seine Kakteen-Sammlung zeigen, seine Mutter würde uns beibringen wie man ein gutes Dizi zubereitet und sein Vater würde uns mit in die Berge nehmen und Roli das Ziegenmelken beibringen.
Die Busfahrt war lange, aber durchaus auch (ent-) spannend. So war zwar die Abfahrt überaus pünktlich, unterwegs verzögerte sich allerdings alles, da immer wieder spontane Stopps eingelegt wurden, um weitere Reisende am Strassenrand oder Güter von Händlern aufzuladen.Im Bus herrscht gute Stimmung, so ein bisschen wie auf einem Schul-Reisli: Jeder dreht am Handy seine Musik hoch, wobei der Fahrer mit seinen grossen Boxen klar den dominantesten Sound lieferte. Telefoniert wurde grundsätzlich laut und gefuttert nach Herzenslust. Der Bus ist der Stolz des Fahrers und es wird viel Wert auf individuelle Cockpit-Gestaltung gelegt: Bunt geschmückt mit Figuren und vielen Lichterketten, die zum Beat der Musik blinken und funkeln. Wenn man mit leicht schläfrig zusammengezwinkerten Augen die ganze Szenerie betrachtet, den Beat der Boxen und das Brummen des Motors auf sich wirken lässt, könnte man für einen kurzen Moment glauben, man stecke gerade in einem Ibiza-Partybus, der deine übernächtigten Passagiere von einem Club zum nächsten schippert. Das war definitiv nicht das Bild des Irans, das wir noch wenige Wochen zuvor in unseren Köpfen gehabt hatten.
Einmal stieg ein alter Mullah zu, worauf die „Party“ unterbrochen wurde und es im Bus ein Weilchen still war. Nach gut einer Stunde war der Alte am Ziel, und als sich die Bustüre hinter ihm geschlossen hatten, ging der Sound wieder an. Mzmzmzmz...
Mit einer Stunde Verspätung ereichte unser Party-Shuttle Teheran, die erste Hürde war geschafft. Unser Freund Aryan wartete bereits, alles wurde im, am und auf dem Auto verstaut und es konnte zum Hotel gehen. Mann, waren wir müde vom vielen Rumsitzen! Späht in der Nacht verabschiedeten wir uns von Selenas Velo und wünschten ihm eine gute Winterpause, see you soon! Bei Aryan wussten wir es in guten Händen.
Bitter Sweet Symphony
Der nächste Tag ging im Nu vorüber. Wir organisierten eine Kartonkiste, um Rolis Velo flugtauglich zu verpacken, und als das geschafft war, zeigte uns Aryan, wo es den besten Kebap Teherans gibt. Das ist übrigens genau gegenüber von dem Laden, in dem es das beste Dizi geben soll; wir haben den Ort gebookmarkt und werden wieder kommen. Bei strömendem Regen, passender hätte es nicht sein können, brachen wir am frühen Abend mit dem Taxi zum Flughafen auf. Unser Lufthansa-Flug sollte zwar erst um 2:25 nachts abheben, aber erstens gab es in Teheran nichts mehr zu tun und zweitens waren wir froh, dass wir genügend Zeit für den Check-In hatten. Teheran Imam Khomeini International Airport ist erstaunlich modern und auch hier waren die Beamten äusserst nett. Trotzdem wirkte die ganze Szenerie irgendwie unwirklich steril auf uns. Die letzten Rials konnten wir im Duty-Free noch in iranischen 1A-Safran umtauschen, und dann ging's auch schon ins Flugzeug. Nun würde Roli bald eine Antwort auf die Frage bekommen, die ihn seit Tagen beschäftigte: War es wirklich wahr, dass auf Flügen aus dem Iran erst nach dem Verlassen des iranischen Luftraums Alkohol ausgeschenkt werden durfte? So ein Campari Soda wäre nicht schlecht... Auf den Bordbildschirmen studieren wir die Karte mit der geplanten Flugroute: Azerbaijan, Georgien mit dem Kaukasus, das Schwarze Meer, Bulgarien, Rumänien... Wofür wir fast 5 Monate benötigt hatten, würde uns der Flieger in knapp 7 Stunden zurück katapultieren. Da war sie also wieder, unsere auf der Karte ach so klein ausschauende Welt, die für uns in den letzten 143 Tagen so unglaublich viel grösser geworden war. Kurz nach dem Start schoben die deutschen Flugbegleiterinnen Getränketrolleys durch die engen Gänge und fanden überall dankbare Abnehmer für Bier und Wein. Die Kopftücher waren von den Köpfen verschwunden, die Lichter des Irans wurden kleiner und kleiner. Müde und etwas belämmert vom ersten Glas Wein seit langem schlummerten wir zum Summen der Motoren ein. Als wir wieder erwachten, befanden wir uns bereits im Landeanflug nach Frankfurt. So schnell kanns gehen.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com